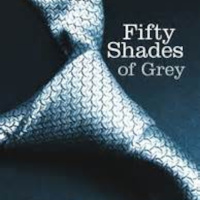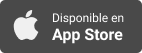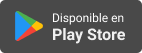Sinopsis
Die Deutsche Welle hat seit ihrem Bestehen (1953) immer wieder über die wichtigsten Meilensteine in der Historie Deutschlands entweder direkt berichtet oder an sie erinnert. Interviews, Statements, Studiodiskussionen oder auch Features zu aktuellen Themen - oder zu deren Jahrestagen - waren ständig Bestandteil des Programms. Die Reihe beginnt mit einem Feature über die Währungsreform im Jahr 1948, in dem Zeitzeugen die Atmosphäre der damaligen Zeit schildern. Die Berufung Bonns zur Bundeshauptstadt, die Schaffung des Bundesgerichtshofes, das deutsch-israelische Wiedergutmachungsabkommen, der Volksaufstand 17. Juni 1953 in der DDR, der Mauerbau oder auch die Ratifizierung der Ostverträge durch den Deutschen Bundestag dies sind nur einige Beispiele der Themen, die in dieser Podcastreihe behandelt werden, wo auch zahlreiche Personen der deutschen Geschichte zu Wort kommen.
Episodios
-
Privatisierung bei der Post - O-Ton-Feature von Axel Brower-Rabinowitsch
22/02/2010 Duración: 14min"Das wird unausweichlich dann zu einer beträchtlichen Verteuerung der Postpakete führen müssen" - der Vorsitzende der Deutschen Postgewerkschaft, Kurt van Harren, spricht über die möglichen Auswirkungen der PostreformEin Wechsel von einem Telefonnetzanbieter zum anderen ist heute so selbstverständlich wie das weltweite Versenden von Mails, einen Telefonapparat kann man heute bei jedem beliebigen Discounter erwerben, und das Angebot "Festnetz-Flatrate" machte ebenfalls schon die Runde und ist jedem ein Begriff. Konkurrenz und Wettbewerb bestimmen heute den Telekommunikations- und Postmarkt. Doch noch bis zum 1.7.89 war dem nicht so. Denn erst ab diesem Tag trat ein Gesetz in Kraft, das dem Kunden diese spätere Freiheit und Vielfalt bescherte. Viel "Kommission" und ein zähes Ringen Zunächst brauchten aber verschiedene Kommissionen von Experten aus Wirtschaft und Politik drei Jahre Zeit, um einen Reformweg für die Bundespost aufzuzeichnen. Nach den Empfehlungen der Berater sollte "der gelbe Riese" mit seinen
-
Neubeginn in Kiel - Landtagswahlen in Schlesig-Holstein nach der Barschel-Affäre und seinem Tod am 11. Oktober 1987 - Feature
16/02/2010 Duración: 17min"Meine Damen und Herren, ... ich wiederhole: ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind" - Ministerpräsident Uwe Barschel bei der Pressekonferenz am 18.9.87Für den "Spiegel" vom 14.9.87 war das ein Ereignis, das das Magazin zum "Watergate in Kiel" bzw. "Waterkantgate" taufte. In dieser Zeit wütete in Schleswig-Holstein nämlich ein Wahlkampf zum Landesparlament, der in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen sollte. Die Hauptkontrahenten: der bisher regierende Ministerpräsident Uwe Barschel (CDU) und sein Herausforderer Björn Engholm (SPD). Doch die Methoden der "politischen Auseinandersetzung", die ans Tageslicht gelangten, waren an Brisanz nicht zu überbieten. Die Enthüllungen des Pressereferenten Reiner Pfeiffer Schon während der Wahl-Kampagne hat die CDU gegen Björn Engholm und die SPD mit "harten Bandagen" gekämpft. So wurde etwa in einer Broschüre behauptet, Engholm wolle "’Neonazis und Kommunisten’ in die Schulen holen… (und) die Jugend 'zu Haß und Klassenk
-
In Bonn wird am 10.10.86 Gerold von Braunmühl von RAF-Terroristen erschossen - Feature über den ersten politischen Mord in Bonn
08/02/2010 Duración: 14min"Wir müssen den Zugang finden zur Terrorszene selbst" - Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann spricht über weitere Vorgehensweise bei der Fahndung nach RAF-TerroristenIm „General-Anzeiger“ vom 10.10.06 wird der ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher mit folgenden Worten zitiert: „Wir empfanden alle das gleiche – tiefe Trauer, Entsetzten, Hilflosigkeit.“ Gemeint hat der Außenminister den Abend am 10.10.86, an dem der Bonner Diplomat Gerold von Braunmühl von den Terroristen der RAF vor seinem Haus in Bonn ermordet wurde. Zwei maskierte Täter schossen den dreifachen Vater mit mehreren Schüssen nieder und flüchteten unerkannt. Später stellte sich heraus, dass als Tatwaffe die gleiche Pistole diente, mit der auch Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleyer ermordet wurde. Sie hinterließen ein Schreiben, in dem sich das „Kommando Ingrid Schubert“ zu dieser Tat bekannte. Als Gründungsmitglied der RAF gehörte Ingrid Schubert zu der so genannten „ersten Generation“ der RAF – sie starb 1977 durch Suizid
-
Unterzeichnung der ersten deutsch-deutschen Städtepartnerschaft zwischen Saarlouis und Eisenhüttenstadt am 19.9.86 - Zwischenbilanz nach 18 Monaten
01/02/2010 Duración: 19min"Diese Partnerschaft ist nicht auf kurzfristige Dinge angelegt, sondern soll langfristig wirken" - Oberbürgermeister von Saarlouis Richard Nospers beschreibt die Ziele der ersten deutsch-deutschen Städtepartnerschaft"Zwei Saarländer unter sich" – "Die Zeit" vom 22.11.85 meinte damit die Visite des Saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine bei einem anderem, nicht weniger bekannten Sohn des Saarlands: Erich Honecker. Mitte der achtziger Jahre waren Besuche bundesdeutscher Politiker in der DDR keine Seltenheit mehr, doch das, was Oskar Lafontaine damals aus Ost-Berlin mitbrachte, sorgte auch international für eine kleine Sensation. Denn bisher bemühte sich das SED-Regime, Kontakte der DDR-Bürger mit der Bevölkerung der BRD möglichst zu beschränken, und nun eine "Wende": die Saarländische Stadt Saarlouis sollte die Möglichkeit erhalten, eine Städtepartnerschaft mit einer DDR-Stadt einzugehen. Wohl die erste deutsch-deutsche! Die Stadtväter Saarlouis’ liebäugelten schon seit längerer Zeit mit einer Part
-
Eberhard von Brauchitsch, Otto Graf Lambsdorff und Hans Friderichs stehen wegen des Verdachts der Korruption vor Gericht - die Skandalgeschichte
25/01/2010 Duración: 14min"Ans Steuerstrafrecht habe ich in der Tat bei diesen Überlegungen nicht gedacht" - Otto Graf Lambsdorff und seine Interpretation der Parteispenden„Kampagne“ – so lautet die Überschrift eines der Kapitel im Buch „Der Preis des Schweigens“ von Eberhard von Brauchitsch. Ab Seite 208 beschreibt von Brauchitsch Ereignisse, die sich für ihn „zum Teil weit jenseits von Recht und Gesetz“ abspielten, die aber einen festen Platz in der Geschichte der Bundesrepublik einnehmen sollten. Die "Spendenwaschanlagen" der Parteien Am 1. März 1982 titelte „Der Spiegel“: „Geld von Flick? Staatsanwälte ermitteln“. Anlass für diesen Artikel war die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Flick-Manger Eberhard von Brauchitsch, Minister Otto Graf Lambsdorff und den Ex-Minister Hans Friderichs im Februar 1982. Dem Verfahren waren lange Ermittlungen in Sachen Parteispenden vorausgegangen, die 1975 durch eine Entdeckung des Bonner Steuerfahnders Klaus Förster initiiert wurden: ein Geflecht von Scheinfirmen und „Spendenwasch
-
Das erste Kabelfernsehprojekt der BRD nimmt am 1. Januar 1984 seinen Sendebetrieb auf - Interview mit Postminister Christian Schwarz-Schilling
18/01/2010 Duración: 09min"Wir werden ein reichhaltiges europäisches Angebot bekommen" - Postminister Christian Schwarz-Schilling schildert die Zukunft des Kabelfernsehens„Ein Start nicht ohne Fehl und Tadel“ („Die Welt“ am 3. Januar 1984), „Der ‚Himmelskanal’ verschlief den Start“ („Süddeutsche Zeitung“, 3. Januar 1984), „Volle Kanäle oder ein Tag im Dschungel der neuen Medien“ („Frankfurter Rundschau“ am 4. Januar 1984) – diese Schlagzeilen der deutschen Presse galten ein und dem selben Ereignis: dem Start des ersten Kabelfernsehprojekts in Ludwigshafen am 1. Januar 1984. Diesem Projekt war seit 1982 eine großangelegte Verkabelung mit Breitbandkabel durch die Bundesdeutsche Post vorausgegangen, die nicht unumstritten war. Als technischer „Träger“ des Kabelfernsehens investierte die Post insgesamt eine Milliarde DM jährlich in diese Technik – für manchen Kritiker ein zu ehrgeiziges und zu kostspieliges Projekt des damaligen Postministers Christian Schwarz-Schilling. Acht Kanäle für die "Privaten" Doch zunächst begann der Start
-
Bundestag billigt am 22. November 1983 die Stationierung der US-Mittelstreckenraketen - Interview mit Bundeskanzler Helmut Kohl
11/01/2010 Duración: 09min"Das Beste was uns überhaupt passieren kann ist, dass es weder amerikanische noch sowjetische Mittelstreckenraketen in Europa gibt" - Helmut Kohl spricht über die bevorstehende Stationierung der MittelstreckenraketenDas Ungleichgewicht der Mittelstreckenraketen Es war eine folgenschwere Rede, die der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt im Oktober 1977 vor dem Londoner Institut für Strategische Studien hielt. In diesem Vortrag stellte Schmidt nämlich ein Ungleichgewicht in der Anzahl der atomaren Mittelstreckenraketen zwischen der Sowjet-Union und der NATO fest. Die neuen russischen SS-20 Raketen stellten dank ihrer Reichweite von 4 000 bis 5 000 Kilometer eine konkrete Bedrohung für ganz Europa dar. Zwar hatte man sich im Salt I Abkommen bereits auf ein Gleichgewicht bei den interkontinentalen Raketen verständigt, doch die Mittelstreckenraketen waren von dieser Vereinbarung unberührt. Schmidts Bestreben war nun, dass diese Waffen in die Verhandlungen zum zweiten Salt-Abkommen mit aufgenommen werden. Doch
-
Erich Honecker kündigt am 5. Oktober 1983 den Abbau von Selbstschussanlgen an - Interview mit Ottfried Hennig
04/01/2010 Duración: 03min"Ich gehe davon aus, dass dies jetzt so durchgeführt wird" - der Staatssekretär Ottfried Hennig kommentiert die Abbauabsichten der Selbstschussanlagen an der innerdeutschen GrenzeEine Pressemeldung sorgt für Wirbel Die deutsche Presse hatte am 28. September 1983 eine Sensation zu vermelden: die DDR wolle die gefürchteten und verhassten Selbstschussanlagen an der innerdeutschen Grenze vollständig abbauen. Doch diese Meldung hatte allerdings einen Schönheitsfehler: diese Ankündigung kam von bundesdeutschen Politikern – eine offizielle Stellungnahme der DDR fehlte bis dato. Erst am 5. Oktober 1983 bestätigte Erich Honecker in einem Interview mit österreichischen Journalisten den vollständigen Abbau der SM 70-Anlagen – inoffiziell eine nette Geste an Franz Josef Strauß nach der Vermittlung eines Milliardenkredits für die DDR. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtete einen Tag darauf: „Ost-Berlin lässt erstmals das Wort ‚Selbstschussanlagen’ drucken.“ Zu diesem Zeitpunkt schätzte man die Anzahl der Tötung
-
Die Bundespost beginnt am 2. September 1983 mit der bundesweiten Einführung von Bildschirmtext (Btx) - Interview mit Erich Dancke
28/12/2009 Duración: 05min"Ende 1986 erwarten wir schon eine Million Teilnehmer" - Erich Dancke beschreibt die Zukunftspläne für den BildschirmtextEine Datenbank im Wohnzimmer Dass man bei „amazon.de“ ein Buch bestellen und zu sich nach Hause liefern kann, das weiß heute fast jeder Bundesbürger. Ebenso kann man heute problemlos einen kostenpflichtigen Artikel bei einer Zeitung erweben, und der Begriff „Online-Banking“ ist den meisten im Zeitalter des Internets gleichermaßen vertraut. Doch bereits im September 1983 wurde vom damaligen Postminister Christian Schwarz-Schilling eine Neuheit offiziell eingeführt, die den Bürgern das Leben erleichtern und der Bundespost möglichst große Einnahmen bescheren sollte. Bildschirmtext – kurz „Btx“ genannt – hieß das Zauberwort, das nun von diesem Zeitpunkt an in aller Munde sein sollte. Schon in der Ausgabe vom 11. September 1983 kündigte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ eine „Datenbank im Wohnzimmer “ an. Das IBM-Desaster Oft wird der Bildschirmtext, der als eine Kommunikationsebene e
-
Bei den vorgezogenen Neuwahlen zum 10. Bundestag ziehen die Grünen mit 5,6% der Stimmen in den Bundestag ein - Interview mit Otto Schily
21/12/2009 Duración: 09min"Im Bereich der Energiepolitik muss ein grundlegender Wandel vorgenommen werden" - Otto Schily schildert die Eckpunkte der Grünen-PolitikDie fünfte politische Kraft im Deutschen Bundestag Für „Die Zeit“ vom 11. März 1983 waren sie „vom Erfolg betäubt“ und „Der Spiegel“ sah in seiner Ausgabe vom 16. März 1983 schon „muntere Zeiten“ in Bonn aufkommen. In einer Karikatur der Münchener „tz“ - die führenden Köpfe der vier etablierten Bundestagsparteien aufgeschreckt von einer kleinen Maus. Mit diesen und ähnlichen Schlagzeilen reagierte die Presse auf den Ausgang der vorgezogenen Bundestagswahl am 6. März 1983. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des bundesdeutschen Nachkriegsparlamentarismus schaffte außer den vier bis dato traditionellen Parteien eine fünfte politische Kraft den Einzug in das Parlament: nämlich „Die Grünen“. 5,6 Prozent der Wählerstimmen ging an eine „bunte Mischung“ aus Lehrern, Journalisten, Physikern, Architekten und anderen vorwiegend akademisch ausgebildeten Mitgliedern der Grünen-Bewe
-
Irrwege eines einst gepriesenen Unternehmens - der „Neue-Heimat-Skandal“ vom Februar 1982
14/12/2009 Duración: 14minDas Sanierungskonzept verfehlte sein Ziel - die Mieter in Angst und Schrecken versetztGemeinnützig und mächtig Der Brockhaus erklärt es auf folgende Weise: gemeinnützig bedeutet „die auf selbstlose Förderung der Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet gerichtete Tätigkeit. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, steht der Gemeinnützigkeit ebenso entgegen wie die Förderung bestimmter Einzelinteressen.“ Als gemeinnütziges Unternehmen war auch die Wohnungsbaugesellschaft „Neue Heimat“ entstanden. Eigentlich entstammte sie der „Kleinwohnungsbaugesellschaft Groß-Hamburg mbH“, die 1926 von dem Hamburger Ausschuss des Deutschen Gewerkschaftsbundes gegründet wurde. Von den Nazis 1933 enteignet, erhielt der Gewerkschaftsbund sein Eigentum 1950 wieder, wonach die Neugründung der Wohnungsbaugesellschaft erfolgte. Bis 1980 errichtete die „Neue Heimat“ rund 470 000 Wohnungen, die – nach dem Willen der Gründer – den Wohnungsnotstand nach dem Krieg lindern sollte. Die Enthüllungen des "Spiegels" Doch
-
Papst Johannes Paul II. besucht die Bundesrepublik Deutschland in den Tagen 15.-19.11.1980
07/12/2009 Duración: 27min"Ein Tausend gelb-weiße Fahnen müssen noch genäht werden" - die Vorbereitungen auf den Papstbesuch in Deutschland laufen auf vollen TourenNach knapp 200 Jahren ein Papst auf deutschem Boden „Ich bin in die Bundesrepublik Deutschland gerade in dem Jahr gekommen, in welchem unsere evangelischen Brüder und Schwestern das Gedächtnis an die vor 450 Jahren verkündete Confessio Augustana gefeiert haben. Möge hier, wo die Reformation ihren Anfang nahm, auch das Bemühen sich verdoppeln, in Treue zum einzigen Herren der Kirche und seiner Botschaft zu wirken“ – diese Worte sprach Papst Johannes Paul II. bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Köln / Bonn am 15. November 1980 aus. Es war der Auftakt einer Pastoralreise, der es an Brisanz durchaus nicht fehlte. Eine schwierige Mission? Denn mit Karol Wojtyla stand seit knapp 200 Jahren wieder ein Papst auf deutschem Boden. Und wie sich bei einer Umfrage des „Spiegels“ vom 10. November 1980 herausstellte, befürworteten lediglich 33 Prozent der befragten Bundesbürger d
-
"Grüne Aktion Zukunft" konstituiert sich am 13.07.1978 in Bonn - sie ist die erste bundesweite Umweltpartei. Interview mit Herbert Gruhl
30/11/2009 Duración: 14min"Hier handelt es sich um eine völlig neue Denkweise, nämlich die ökologische" - Herbert Gruhl spricht über seine Partei "Grüne Aktion Zukunft"Die Grünen-Bewegung auf dem Vormarsch „Bahr warnt vor grünen Listen“ – schrieb die „Frankfurter Rundschau“ in ihrer Ausgabe vom 10. Januar 1978; der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete am 8. März 1978 über den „Streit über Erfolge der Grünen“ – gemeint waren hier die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein; die „Stuttgarter Zeitung“ titelte am 18. Mai 1978 „Genscher warnt vor den Grünen“; „Die Welt“ fragte in ihrem Kommentar am 10. Juni 1978: „Die Grünen als vierte Partei bundesweit?“ – die weitere Entwicklung der politischen Landschaft in der BRD sollte diese Frage recht bald bejahen. Denn: Zunehmende Wahlerfolge der Grünen Listen bei den Kommunal- und Landtagswahlen im Jahr 1978 mischten auch das Bonner Politparkett immer intensiver auf. Schon allein die Vielfalt der „Öko-Listen“ und Bürgerinitiativen war enorm. Die erste bundesweite grüne Partei - "Das grüne Manifes
-
Das Bundesdatenschutzgesetz tritt am 01. Jaunuar 1978 in Kraft. Erster Bundesbeauftragter für den Datenschutz wird im Februar Hans Peter Bull
23/11/2009 Duración: 14min"Persönlichkeitsprofile sollen vermieden werden" - der erste Bundesdatenschutzbeauftragte Hans Peter Bull spricht über den DatenschutzDie Idee eines Datenschutzgesetztes war 1978, dem Jahr der Einführung eines Bundesdatenschutzgesetztes, gar nicht so neu. Denn sie entstand bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Zwei Anwälte, Samuel D. Warren und Louis Dembitz Brandeis, prägten dort - angesichts des zunehmenden Eindringens der Presse in die privaten Belange der Bürger - den Begriff „right to privacy“, also „Recht auf Privatsphäre“. Doch was sich damals noch auf Karteikarten und in sonstigen Notizen in den (meist privaten) Archiven an Personenangaben und sonstigen Informationen befand, entwickelte sich im Laufe der zunehmenden Automatisierung bis hin zur elektronischen Speicherung zu einer wahren Informationsflut an persönlichen Daten. Das erste Datenschutzgesetz der Welt Doch zunächst blieb es nur bei Forderungen nach einem Datenschutzgesetz. In der BRD hat der Bundesgerichtshof 1954 erstmals
-
Der Bundestag verabschiedet am 24. Juni 1976 das so genannte Anti-Terrorismus-Gesetz - Interview mit Hans-Jochen Vogel
16/11/2009 Duración: 11min"Diese Gesetze schließen Lücken" - Bundesminister der Justiz Hans-Jochen Vogel kommentiert das Anti-Terrorismus-Gesetz„Unionsländer wollen ‚zähneknirschend’ dem Anti-Terror-Gesetz zustimmen“ - schrieb die „Kölnische Rundschau“ am 29. Juli 1976. Gemeint hat die Zeitung das vom Bundestag verabschiedete so genannte Anti-Terrorismus-Gesetz. Die Bestimmungen Der Paragraph 129a des Strafgesetzbuches stellte nun eindeutig klar, dass die „Bildung terroristischer Vereinigungen“ einen Straftatbestand erfüllt, der mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren geahndet werden kann, für Rädelsführer oder Hintermänner wurde eine Strafe zwischen einem und zehn Jahren Haft vorgesehen. Zudem waren auch Einschränkungen in der schriftlichen Kommunikation zwischen den Anwälten und den Angeklagten vorgesehen, die Zuständigkeit für derartige Delikte wurde in die Zuständigkeit des Bundesanwalts gelegt. Jedermann wurde dazu verpflichtet, die Planung oder Gründung solcher Vereinigungen anzuzeigen. Die Partei
-
Als erster israelischer Regierungschef besucht Ministerpräsident Yitzhak Rabin vom 08. - 12. 7.1975 die Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin
09/11/2009 Duración: 03min"Berlin ist für das Verhältnis der Juden und der Deutschen zueinander immer ein besonderer Platz gewesen" - Klaus Schütz, der Regierende Bürgermeister von West-Berlin, begrüßt Yitzhak Rabin„Wir können nichts ungeschehen machen, was geschehen ist. Die Summe des Leides und des Schreckens lässt sich nicht aus dem Bewusstsein unserer Völker verdrängen. Die Zusammenarbeit unserer Staaten bleibt durch den historischen und moralischen Hintergrund unserer Erfahrungen geprägt“ – Willy Brandt hielt seine Begrüßungsrede bei seinem Besuch als erster deutscher Bundeskanzler in Israel im Juni 1973 damals noch auf Englisch. Doch dieser Besuch sollte erst der Anfang eines Annährungsprozesses zwischen den Deutschen und den Israelis werden. Ein Besuch aus Israel in West-Berlin – ein Dorn in den Augen der kommunistischen Machthaber im Osten Zwei Jahre später, im Juli 1975, kam nun auch der erste offizielle Besuch aus Israel in die BRD. Der damalige israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin begann seine Visite im ehemali
-
Die BRD (Deutscher Sportbund) und die DDR (Deutscher Turn- und Sportbund) unterzeichnen am 08. Mai 1974 ein Sportabkommen - Interview mit Horst Korber
02/11/2009 Duración: 03min"Eine Signalwirkung auf die osteuropäischen Staaten" - der Berliner Justizsenator Horst Korber bewertet den deutsch-deutschen SportvertragDie „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hat in ihrer Ausgabe vom 8. Mai 1984 resümiert: „Ein Jubiläum, aber kein Grund zum Feiern“. Auf den Tag genau waren zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Jahre verstrichen, als man das deutsch-deutsche Sportabkommen unterzeichnete. Zwei Sondierungsgespräche und fünf Verhandlungsrunden waren notwendig, um einen Vertrag zwischen dem Deutschen Sportbund der BRD und dem Turn- und Sportbund der DDR unterschriftsreif auszuhandeln, der dann auch am 8. Mai 1974 unterzeichnet wurde. Eine „neue Ära“ der Sportbeziehungen zwischen beiden deutschen Staaten sollte nun eingeläutet werden, zumal sie seit 13 Jahren – also seit dem Bau der Mauer – völlig brach lagen. „Berlin-Ost“ und „Berlin-West“ beim bilateralen Sportverkehr Neben zahlreichen anderen, gab es bei den Verhandlungen einen besonders schwierigen Knackpunkt. Die bundesdeutsche Delegation best
-
Der Deutsche Bundestag beschließt am 22.03.1974 die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters von 21 auf 18 Jahre
26/10/2009 Duración: 03min"Nun voll geschäftsfähig" - Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel erklärt das neue VolljährigkeitsgesetzDie Diskussion über die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters von 21 auf 18 Jahre war 1974 nicht mehr neu. Denn die ersten Vorschläge diesbezüglich wurden bereits 1966 gemacht. In ihrer Ausgabe vom 14. Januar 1966 hat „Die Zeit“ schon mal gefragt: „Sollen Teenager wählen?“. Zu dieser Frage hat sie nämlich eine Initiative junger Bundestagsabgeordneter veranlasst, die – und das wohl parteiübergreifend – das Wahlrecht für bereits 18jährige Bundesbürger vorschlug. Einer dieser jungen Abgeordneten war der spätere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, der 1965 in den Bundestag kam. Viel „Neues“ für 18-Jährige Doch es dauerte noch acht Jahre bis der Bundestag 1974 schließlich diese Reform des Wahlrechts beschloss und es fehlte dabei nicht an Argumenten, die sowohl für als auch wider diese Neuerung sprachen. Zugleich haben die Volksvertreter eine ganze Reihe von Neuerungen und Änderungen beschlossen. S
-
06. März 1974: NRW-Landesregierung beschließt die Gründung der ersten bundesdeutschen Fernuniversität in Hagen
19/10/2009 Duración: 14min"Über 85 Prozent unserer Studenten sind berufstätig" - Prof. Otto Peters beschreibt die Studentenschaft an der Hagener Fernuniversität200 000 Fernstudenten sollten es jährlich werden – so die Prognose des damaligen NRW-Wissenschaftsministers und späteren Bundespräsidenten Johannes Rau in einem Interview mit dem „Spiegel“ vom 25. März 1974. Die Zeit sollte später diese Erwartungen eindämmen, doch zunächst nahm die erste bundesdeutsche Fernuniversität in Hagen 1975 ihren Betrieb auf. Die Universitäten entlasten Über 1300 Studierende waren es nun, die in diesem Jahr als erste die Möglichkeit eines Fernstudiums in drei Fachbereichen wahrnahmen. Einen der Gründe für die Errichtung der Fernuniversität nannte Johannes Rau ebenfalls in dem schon zitierten "Spiegel"-Interview: „Natürlich kommen wir dem Ideal des Lernens und Lehrens in Muße und Abgeschiedenheit nicht näher. Aber alle Schwierigkeiten addiert, ist unsere Lösung immer noch besser als ein Heer abgewiesener Studenten.“ Und Johannes Rau wusste damals wo
-
Reportage vom Beitritt der BRD und der DDR zur UNO am 18. September 1973
12/10/2009 Duración: 06min"Premierenstimmung": Hanswolf Haunhorst berichtet vom Beitrittsakt beider deutschen Staaten bei der UNOAm 5. Juli 1972 hatte die SED-Zeitung „Neues Deutschland“ unter anderem eine lapidare Meldung zu bieten: „Dr. Waldheim erneut für Universalität der UNO“. Gemeint war damit auch die Mitgliedschaft der BRD und der DDR in dieser Welt-Organisation. Doch es sollten noch weitere 14 Monate vergehen, bis die beiden deutschen Staaten vollberechtigte Mitglieder der Vereinten Nationen werden durften. Bis dahin konnte die Bonner Regierung die Bestrebungen der DDR um die staatliche Anerkennung unterminieren – wohl auch mit Hilfe von Milliardenbeträgen, die die BRD an die UNO überwies. Erst der Grundlagenvertrag, den die Bonner Regierung dem SED-Regime abgetrotzt hatte, ebnete für die beiden deutschen Staaten den Weg in die Vereinten Nationen. Mitglieder 133 und 134 ohne Abstimmung Am 18. September 1973 war es nun so weit: die Mitglieder 133 (DDR) und 134 (BRD) sollten offiziell in die Staatengemeinschaft aufgenommen